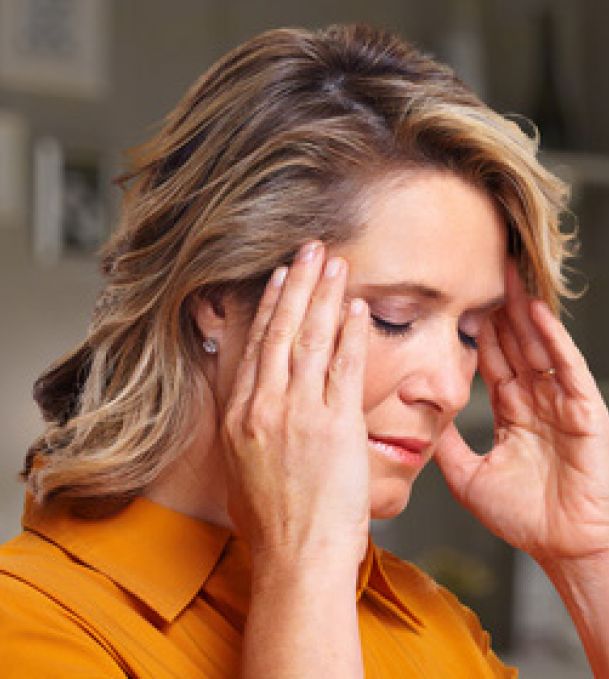Herzlich willkommen auf meiner Website!
Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an meinem privatärztlichen Hausbesuchsdienst. Neben meiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Neurochirurgie, Neurologie und Schmerzmedizin bin ich auch Autor zweier Fachbücher über Bandscheibenerkrankungen der Lendenwirbelsäule sowie eines umfassenden neurologischen Werkes.
Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Seite, wenn Sie medizinische Unterstützung benötigen – einfühlsam, kompetent und direkt bei Ihnen vor Ort.
Zögern Sie nicht, mich bei Fragen oder Terminwünschen jederzeit zu kontaktieren.
Telefon: 0152 06 05 69 69
24-Stunden Privatärztlicher Notdienst
für Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach am Main und Umgebung
Ich biete Ihnen rund um die Uhr einen zuverlässigen privatärztlichen Notdienst in folgenden Städten und Regionen an:
Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach am Main, Gießen, Marburg, Fulda, Rüsselsheim am Main, Bad Homburg vor der Höhe, Wetzlar, Oberursel (Taunus), Rodgau, Dreieich, Bensheim, Hofheim am Taunus, Maintal, Neu-Isenburg, Langen (Hessen), Limburg an der Lahn, Mörfelden-Walldorf, Dietzenbach, Viernheim, Bad Nauheim, Lampertheim, Friedberg (Hessen), Taunusstein, Bad Hersfeld, Kelkheim (Taunus), Mühlheim am Main, Rödermark, Hattersheim am Main, Griesheim, Butzbach, Heppenheim (Bergstraße), Groß-Gerau, Weiterstadt, Friedrichsdorf, Idstein, Pfungstadt, Obertshausen, Riedstadt, Gelnhausen, Dillenburg, Bad Soden am Taunus, Karben, Büdingen, Eschborn, Flörsheim am Main, Seligenstadt, Bruchköbel, Herborn, Nidderau, Heusenstamm, Kronberg im Taunus, Hochheim am Main, Nidda, Bad Wildungen, Babenhausen, Kelsterbach, Königstein im Taunus, Bürstadt, Reinheim, Seeheim-Jugenheim, Raunheim, Michelstadt, Schlüchtern, Erlensee, Dieburg, Schwalbach am Taunus, Witzenhausen, Fritzlar, Büttelborn, Usingen, Gründau, Groß-Zimmern, Langenselbold, Mainz, Aschaffenburg, Mannheim, Worms.
Für eine schnelle und kompetente medizinische Versorgung – wann immer Sie mich brauchen.
Migräne
Einführung
Berühmte Persönlichkeiten wie Marie Curie, Karl Marx und Königin Elisabeth II. litten unter Migräne. Migräne ist weit verbreitet und zählt zu den häufigsten Krankheiten, mit denen Ärzte im klinischen Alltag konfrontiert werden. Schätzungen zufolge leiden etwa 6–8 % der Männer und 12–14 % der Frauen unter Migräne. Auch 4–6 % der Kinder sind betroffen. Frauen sind etwa dreimal häufiger betroffen als Männer. Die meisten Migräneanfälle treten zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr auf. Zudem zeigt sich, dass Patienten mit schweren Depressionen oder Angststörungen häufiger unter Migräne leiden. Schmerztherapeuten verfolgen zwei Ziele: Einerseits die Symptome zu lindern, andererseits die Häufigkeit der Migräneattacken zu reduzieren.
Die International Headache Society (IHS) teilt Kopfschmerzen in zwei Hauptgruppen ein: primäre und sekundäre Kopfschmerzen. Spannungskopfschmerzen, Migräne und Clusterkopfschmerzen gehören zu den primären Kopfschmerzen. Diese machen über 95 % aller Kopfschmerzen aus und treten ohne eine andere strukturelle Erkrankung auf. Sekundäre Kopfschmerzen werden durch andere Erkrankungen verursacht, z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Gefäßstörungen im Kopf- und Halsbereich, Infektionen oder psychiatrische Erkrankungen.
Für Migräne gibt es wirksame Medikamente zur Behandlung akuter Attacken und zur Verringerung der Anfallshäufigkeit. Auch nicht-medikamentöse Therapien wie aerober Ausdauersport, Entspannungsverfahren, verschiedene verhaltenstherapeutische Methoden und Akupunktur zeigen gute Erfolge.
Migräne – Allgemeines
Nach Spannungskopfschmerzen ist Migräne die zweithäufigste Kopfschmerzform. Das Kardinalsymptom ist ein Attackenkopfschmerz, der 4 bis 72 Stunden andauert, meist halbseitig beginnt und häufig mit Übelkeit, Erbrechen sowie Licht- und Lärmempfindlichkeit einhergeht. Etwa die Hälfte der Betroffenen sucht wegen ihrer Beschwerden keinen Arzt auf.
Die IHS unterscheidet zwei Haupttypen:
-
Migräne ohne Aura
-
Migräne mit Aura
Migräne ohne Aura ist eine primäre, wiederkehrende Kopfschmerzerkrankung, die ohne Behandlung oder bei erfolgloser Behandlung 4–72 Stunden anhält. Mindestens zwei der folgenden Merkmale müssen vorliegen:
Zudem müssen mindestens eines der folgenden Begleitsymptome vorhanden sein: Übelkeit und/oder Licht- und Lärmempfindlichkeit. Diese Form ist die häufigste.
Bei 15–20 % der Patienten tritt eine Aura vor dem Migräneanfall auf. Die Migräne mit Aura zeigt sich durch reversible, fokale neurologische Symptome wie Lichtblitze, verschwommenes Sehen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle im Gesicht oder Körper, bis hin zu Sprachstörungen oder Lähmungen. Diese Aura entwickelt sich langsam und dauert nicht länger als eine Stunde.
Phasen eines Migräneanfalls
Ein Migräneanfall gliedert sich in vier Hauptphasen:
Vorbotenphase:
Ca. 30 % der Betroffenen berichten Stunden bis zwei Tage vor dem Anfall über Symptome wie:
Auraphase:
Bei 10–15 % der Patienten tritt eine Aura auf, nicht bei jedem Anfall. Sie äußert sich durch:
Die Aura entwickelt sich langsam, dauert 30–60 Minuten und klingt meist von selbst ab.
Kopfschmerzphase:
Unmittelbar nach der Aura beginnt die Kopfschmerzphase, die 4 bis 72 Stunden andauert. Typisch sind starke, oft halbseitige Kopfschmerzen mit Begleitsymptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit.
Erholungsphase:
Nach dem Kopfschmerz klingen die Symptome vollständig ab. Die Betroffenen fühlen sich müde und erschöpft. Diese Phase dauert meist bis zu 24 Stunden.
Ursachen der Migräne
Die genauen Ursachen der Migräne sind noch nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich spielen genetische Faktoren eine Rolle, denn Angehörige von Migränepatienten haben ein 1,5- bis 4-fach erhöhtes Risiko, ebenfalls zu erkranken. Vermutet wird eine Störung im Gleichgewicht des Hirnstamms. Diese führt zu einer neurogenen Entzündung der Blutgefäße in der Hirnhaut (Dura), die an der Schmerzübertragung beteiligt ist. Der Botenstoff Serotonin scheint bei diesem Prozess eine wichtige Rolle zu spielen. Während einer Migräneattacke lassen sich häufig erhöhte Serotoninspiegel im Blut nachweisen.
Auslöser der Migräneattacke (Triggerfaktoren)
Triggerfaktoren lösen eine Migräneattacke aus, sind aber nicht die Ursache der Erkrankung selbst. Häufig sind mehrere Faktoren beteiligt, darunter:
-
Stress
-
Emotionen (sowohl positive als auch negative)
-
Hormonschwankungen (z. B. Menstruation)
-
Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus
-
Alkohol
-
Bestimmte Nahrungsmittel
-
Medikamente
Sehr häufig genannt werden Stress (77 %), Menstruation (72 %), helles oder flackerndes Licht (65 %) sowie verschiedene Gerüche (61 %). Das Erkennen der individuellen Triggerfaktoren kann helfen, Attacken zu vermeiden.
Migräneformen
Migräne ohne Aura:
Die häufigste Form, die meist in den frühen Morgenstunden beginnt. Körperliche Aktivität verschlimmert die Beschwerden. Dauer 4–72 Stunden.
Migräne mit Aura:
Gekennzeichnet durch vorangehende neurologische Symptome wie Sehstörungen, Missempfindungen und Schwindel. Aura dauert etwa 30–60 Minuten.
Sonderformen:
-
Migräne sans migraine: Sehr selten, ältere Patienten erleben Aura ohne Kopfschmerzen. Muss unbedingt abgeklärt werden, da es ein Schlaganfallzeichen sein kann.
-
Menstruelle Migräne: Tritt während oder kurz vor der Menstruation auf, meist ohne Aura, ausgelöst durch Östrogenabfall.
-
Familiäre Hemiplegische Migräne: Seltene Form mit halbseitigen Lähmungen, die familiär gehäuft auftreten.
-
Status migränosus: Seltene, langanhaltende Attacke von über 72 Stunden, mit starker Schmerzintensität und hoher Beeinträchtigung der Lebensqualität.
Diagnose
Migräne wird meist anhand der Krankengeschichte diagnostiziert. Der Arzt fragt nach Lokalisation, Dauer, Häufigkeit, Art und Begleitsymptomen der Kopfschmerzen. Eine neurologische Untersuchung ist empfehlenswert. Bildgebende Verfahren wie CT oder MRT kommen nur zum Einsatz, wenn der Verdacht auf andere Ursachen besteht.
Hilfreich ist das Führen eines Schmerzkalenders über 4–6 Wochen, in dem Patienten Zeitpunkt, Art, Stärke, Dauer, Begleitsymptome und Triggerfaktoren dokumentieren.
Therapie
Migräne hat bio-psycho-soziale Ursachen. Ein ganzheitlicher Therapieansatz, der medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen kombiniert, führt meist zum Erfolg.
Nicht-medikamentöse Therapien:
Medikamentöse akute Behandlung:
-
Antiemetika (z. B. Metoclopramid, Domperidon) zur Linderung von Übelkeit und zur Verbesserung der Wirkstoffaufnahme.
-
Nicht-opioide Analgetika (Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol etc.) bei milden bis mäßigen Attacken. Kombinationen (z. B. ASS, Paracetamol, Coffein) können wirksamer sein.
-
Triptane bei starken Attacken – Serotonin-5-HT-Agonisten mit gefäßverengender und entzündungshemmender Wirkung. Nicht geeignet bei Gefäßkrankheiten oder bestimmten Risikofaktoren.
Die Einnahme von Akutmedikamenten sollte auf maximal 10 Tage im Monat begrenzt werden, um medikamenteninduzierten Kopfschmerz zu vermeiden.
Notfallbehandlung:
Intravenöse Gabe von ASS ± Metoclopramid oder subkutane Sumatriptan-Injektion. Bei Status migränosus Einsatz von Kortikosteroiden.
Migräneprophylaxe
Empfohlen bei:
-
Drei oder mehr Attacken pro Monat
-
Attacken über 72 Stunden Dauer
-
Schmerzmittelgebrauch an mehr als 10 Tagen pro Monat
Medikamentöse Prophylaxe:
Erste Wahl: Betablocker (Propranolol, Metoprolol), Kalziumkanalblocker (Flunarizin), Antiepileptika (Valproinsäure, Topiramat).
Zweite Wahl: Amitriptylin, Naproxen, ASS, Gabapentin, Pestwurz, Magnesium.
Nicht-medikamentöse Prophylaxe:
-
Progressive Muskelentspannung
-
Biofeedback
-
Akupunktur
-
Ausdauersport (3-mal wöchentlich je 30 Minuten, z. B. Joggen oder Walken)
Sport senkt den Stresslevel und wirkt wie ein Entspannungstraining, wodurch die Häufigkeit der Attacken reduziert wird. Wichtig ist, Unterzuckerung zu vermeiden, da diese Migräne auslösen kann.
Zusammenfassung
Migräne ist eine häufige neurologische Erkrankung mit komplexer Ursache. Sie äußert sich in wiederkehrenden, meist halbseitigen Kopfschmerzattacken mit Begleitsymptomen. Die Behandlung umfasst medikamentöse Akut- und Prophylaxetherapien sowie wirksame nicht-medikamentöse Verfahren. Das Erkennen von Triggerfaktoren und ein ganzheitlicher Therapieansatz verbessern die Lebensqualität der Betroffenen erheblich.
„Die Ratschläge dienen nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung und ersetzen keinen Arztbesuch.“