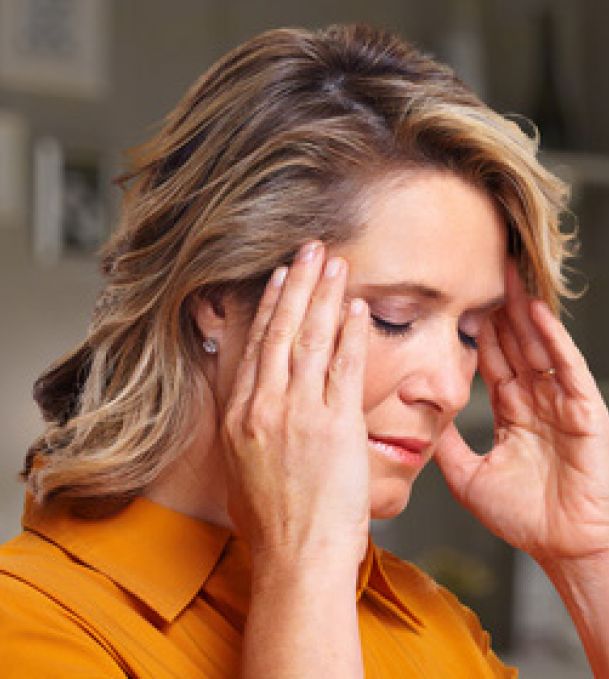24 Stunden Privatärztlicher Notdienst
Medizinische Dienste vor Ort
Tel: 0152 06 05 69 69
Rund um die Uhr
24 Stunden Privatärztlicher Notdienst für Frankfurt, Offenbach, Bad Homburg, Bad Vilbel, Eschborn, Friedrichsdorf im Taunus, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Neu Isenburg, Butzbach, Florstadt und Rhein-Main-Gebiet
Meningeom
Das Meningeom ist die häufigste Art von Hirntumor und macht etwa 30 % aller Hirntumoren aus, von denen die meisten heilbar sind. Tatsächlich können die meisten dieser Tumore chirurgisch entfernt werden, und viele werden nicht wiederkehren. Meningeome wachsen im Allgemeinen langsam und sind in den meisten Fällen gutartig.
Meningeom entsteht aus den Membranschichten, die das Gehirn und das Rückenmark bedecken, nicht aus dem Hirngewebe. Etwa 90 Prozent der Meningeome sind gutartig – was bedeutet, dass sie sich wahrscheinlich nicht im ganzen Körper ausbreiten – und wachsen langsam über Monate oder sogar Jahre. Ein Meningiom kann jedoch ziemlich groß werden und das Gehirn und andere Strukturen im Schädel komprimieren. Die Prävalenz dieses Tumors ist bei Frauen höher als bei Männern.
Es sollte beachtet werden, dass eine kleine Anzahl von Meningeom-Tumoren bösartig ist, deren Wachstumsrate sehr hoch ist und die in andere Teile des Gehirns und andere Organe metastasieren kann.
Meningeome treten normalerweise still auf und haben eine sehr geringe Progressionsrate, ihre Symptome werden zu Beginn der Krankheit nicht beobachtet.
Die Symptome dieser Krankheit umfassen in den meisten Fällen Kopfschmerzen, Krämpfe, Sehstörungen (verschwommenes Sehen), Schwäche in Händen und Füßen, Taubheit und Kribbeln sowie Sprachstörungen.
Meningeome werden in drei Gruppen eingeteilt: gutartige (90%), atypische (5%) und anaplastische (3-5%). In 90 % der Fälle ist der Tumor gutartig und bedarf keiner sofortigen Behandlung.
- Benigne: Der zerebrale Meningeom-Tumor wächst sehr langsam und hat in den meisten Fällen keine Symptome. In diesen Fällen ist keine Operation erforderlich und es ist eine regelmäßige MRT-Untersuchung erforderlich, um den Krankheitsverlauf zu verfolgen. In Fällen, in denen die Krankheitssymptome die Lebensqualität der betroffenen Person beeinträchtigen und den normalen Lebensablauf stören, wird eine Operation zur Entfernung des Tumors vorgeschlagen.
- Atypisch: Diese Art von zerebralem Meningeom ist etwas aggressiver als die gutartige Art und das Risiko eines erneuten Auftretens ist höher als bei beningnen Meningeom. Die Operation ist der erste Behandlungsansatz für diese Art von Meningeom, und in einigen Fällen nach der Operation steht auch eine Strahlentherapie auf der Tagesordnung.
- Anaplastisch: Es ist eine aggressive und fortschreitende Art von Meningeom, eine Operation und anschließende Strahlentherapie ist die erste Wahl, um mit dieser Art von Meningeom umzugehen. In Fällen, in denen ein Wiederauftreten der Krankheit beobachtet wird, steht eine Chemotherapie auf der Tagesordnung.
Symptome
Ein kleines Meningeom kann überhaupt keine Symptome verursachen. Meningeom wächst langsam und der Patient kann jahrelang keine Symptome haben und der Tumor kann zufällig auf einem MRT- oder CT-Scan gesehen werden, der aus einem anderen Grund durchgeführt wird. Die Symptome eines Meningeoms variieren je nach Lage und Größe des Tumors. Wenn sich das Meningeom vergrößert, erhöht es den intrakraniellen Druck und verursacht Probleme wie:
- Allgemeiner Druck im Kopf, der zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führt
- Spezifische Symptome aufgrund der Lokalisation: Zum Beispiel kann Meningeom-Druck auf den Sehnerv Sehprobleme verursachen. Ein anderer Tumorort kann die motorischen oder sprachlichen Fähigkeiten beeinträchtigen.
- Krämpfe
- Ein größeres Meningeom kann den Fluss der Zerebrospinalflüssigkeit blockieren, was zu einem Hydrozephalus führt, der das Gehen und das Gedächtnis beeinträchtigen kann.
Ursachen
Gegenwärtig ist die Hauptursache des zerebralen Meningeoms nicht bekannt, aber es wurde eine Reihe von Risikofaktoren für diese Krankheit identifiziert, die stark mit der Entwicklung des Meningeoms zusammenhängen. Einige dieser Faktoren umfassen die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung, Hormone, genetische Faktoren und die Verwendung von Mobiltelefonen.
Ionisierende Strahlung wie Röntgenstrahlen kann eine Vielzahl von Malignomen verursachen, indem sie DNA-Doppelstrangbrüche verursacht, von denen Gehirnmeningeome ein Teil dieser Malignome sind. Außerdem ist ionisierende Strahlung für die Entstehung von Meningeomen verantwortlich. Die Überlebenden der Atombombe haben also ein erhöhtes relatives Risiko, solche Tumore zu entwickeln. Insbesondere bei Kindern, die wegen Leukämie oder ZNS-Tumoren bestrahlt wurden, zeigte sich ca. 10-fach erhöhtes Risiko, nach durchschnittlich 17 Jahren ein Meningeom zu entwickeln.
Erbliche Tumorsyndrome spielen eine große Rolle, wie Neurofibromatose Typ 2 (NF2), die autosomal-dominant vererbt wird und durch einen Gendefekt auf Chromosom 22q11-13.1 verursacht ist. Dieses Gen kodiert für das Tumorsuppressorprotein Merlin (auch Schwannomin genannt), welches an der Regulierung der Zelladhäsion und -proliferation beteiligt ist. Ungefähr 50-75 % von NF2-Patienten entwickeln Meningeome – manchmal mehrere.
Es wurden mehrere Studien über die Beziehung zwischen Hormonen und dem Auftreten von zerebralen Meningeomen durchgeführt. Inzwischen wurde eine starke Beziehung zwischen Meningeom und Östrogen-, Progesteron- und Androgenhormonrezeptoren beobachtet. Beispielsweise wurde über Veränderungen der Größe von Meningeom-Tumoren im Gehirn während der Schwangerschaft oder bei Frauen mit Brustkrebs berichtet.
Zusätzlich zu den genannten Faktoren wurde auch der Zusammenhang zwischen Faktoren wie Kopf- und Nackenverletzungen und der Verwendung von Mobiltelefonen untersucht, aber aus diesen Studien wurden keine akzeptablen Ergebnisse gemeldet.
Komplikationen
Aufgrund des langsamen Wachstums des Meningeoms treten seine Komplikationen langsam auf.
- Kopfschmerzen
- Krämpfe
- Visusminderung, Gesichtsfeldausfälle
- Schwäche in Armen und Beinen
- Sprachstörung
Diagnose
Die moderne Bildgebung ermöglicht die Darstellung kleiner Tumore. Da Meningeome oft langsam wachsen und kaum Symptome verursachen, werden sie oft zufällig entdeckt. Meningeome sind insbesondere bei T1-gewichtetem MRT und CT gut erkennbar. Meningeome erscheinen im MRT meist iso- oder hypointens zum Kortex in T1-Wichtung und iso- oder hypertens in T2- Wichtung.
Im CT stellen sich Meningeome – im Vergleich zum Hirnparenchym – meist isodens, gelegentlich auch hyper- oder leicht hypodens sowie scharf umschrieben und breitbasig an der Dura anheftend dar. Eine Hyperostose ist dabei eher mit benignen Meningeomen assoziiert und deutet auf eine Knocheninfiltration hin, während bei atypischen und malignen Tumoren oft eine Knochendestruktion vorkommt.
Behandlung
Die Wahl der richtigen Behandlung für Hirnmeningeome hängt von Faktoren wie der Lage des Meningeoms im Gehirn, der Art des Meningeoms (gutartig oder bösartig) und dem Allgemeinzustand des Patienten ab.
Krankheitsverlauf beobachten
Da das Meningiom einen langsamen Verlauf hat und auf der Grundlage der körperlichen Bedingungen und Erkrankungen der Person und des Alters des Patienten besteht, stellt es für ihn keine Gefahr dar, und zwar in Fällen, in denen der Patient keine spezifischen Symptome hat. Man wird den Krankheitsverlauf durch regelmäßige Bildgebung überwachen, um einen Krankheitsfortschritt rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls eine Operation durchzuführen.
Hirnoperation
Ziel der Operation ist es, so viel Tumor wie möglich zu entfernen. Es ist auch möglich, den Tumor vollständig zu entfernen. Die Wahrscheinlichkeit eines Tumorwachstums um wichtige Nerven und Blutgefäße ist sehr gering. In Fällen, in denen das Meningeom gutartig ist und seine Symptome die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigen und es sich an einem Ort befindet, an dem der Chirurg uneingeschränkten Zugang dazu hat, ist die Tumorentfernung die beste und einzige Behandlungslösung.
Bei dieser Operation wird ein kleiner Teil des Schädelknochens entfernt, damit der Neurochirurg Zugang zum Tumor hat. Dann kann der Neurochirurg den gesamten Tumor oder einen Teil davon entfernen. In Fällen, in denen der gesamte Tumor nicht entfernt werden kann, steht eine Strahlentherapie auf der Tagesordnung.
Strahlentherapie
In Fällen, in denen Hirnmeningeome bösartig sind oder der Arzt den Tumor nicht vollständig entfernen kann, steht der Einsatz einer Strahlentherapie auf der Tagesordnung. Bei dieser Art der Behandlung wird Strahlentherapie verwendet, um Krebszellen zu zerstören oder das Tumorwachstum zu stoppen. Auch in Fällen, in denen kein Zugang zum Tumor möglich ist, kommt dieses Behandlungsverfahren zum Einsatz.
Chemotherapie
Eine Chemotherapie wird nicht oft zur Behandlung von Meningeomen eingesetzt. Wenn der Tumor erneut auftritt und schnell wächst, wird eine Chemotherapie in Betracht gezogen.
Die Ratschläge darf nicht zur Selbstdiagnose-oder -behandlung verwendet werden und kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.